Katholische Pfarrgemeinde Sankt Pankratius Vorhelm
Einrichtungen
(Beim Anklicken der "blau" unterlegten Wörter kommen Sie zu den Informationen und durch Anklicken werden die Fotos größer)
Ein kurzer Führer durch die Ortsgeschichte und die Kirche St. Pankratius zu Vorhelm
(Zusammenstellung durch Pastor em. Hermann Honermann)
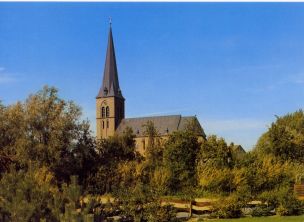 Außenansicht |
 Blick aus der Luft |
 Innenansicht |
 Innenansicht - Ostern 2016 |
 Innenansicht - 2023 nach Neuanstrich |
Kurztexte und Tafeln zur Vorhelmer Geschichte: Zu Vorhelms Geschichte haben sich im Internet einige Fehler eingeschlichen, die korriegiert werden müssen. Dazu dienen diese Texte:
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Spuren
der Vergangenheit
Archäologische Untersuchungen gerade in
jüngster Zeit haben zu neuen Erkenntnissen
geführt. Funde aus der Steinzeit und der
Bronzezeit belegen, dass damals schon Menschen das
Gebiet um Vorhelm durchstreiften. Aus dem
Jahrhundert vor Christus wurden keltische Münzen
und Fibeln gefunden. Bereits kurz vor Christus gab
es in mehreren Bereichen Vorhelms
dauerhafte Siedlungen. Die Zeit der
Völkerwanderungen bedeutete auch für Vorhelm
manche Umbrüche. Danach aber ist Vorhelm
durchgehend besiedelt gewesen.
Der
Name „Vorhelm“
In Vorhelm kreuzten zwei alte Handelswege:
Der „Hellweg“, der von Norden nach Süden führte und
hinter Vorhelm zum Galgenberg anstieg. Dann die
„Friesenstraße“, die von Westen
nach Osten ging und ebenfalls hinter Vorhelm zu den
Beckumer Bergen anstieg. Dieser Anstieg hieß „Helle“.
Jahrhunderte lang machten Durchreisende die Erfahrung,
dass Vorhelm der
Ort vor der „Helle“, vor dem Anstieg war, und nannten
ihn schließlich „Vor-Helle-Heim“, woraus der Name
Vorhelm entstand.
Wulfbert
und Amulger
Nach
langen Kriegen hatte Karl der Große die Sachsen
unterworfen. Unter dem heiligen Liudger und seinen
missionarischen Mitarbeitern fanden die Sachsen zum
christlichen Glauben. Im Jahr 805 soll
Liudger in Ahlen einen Blinden geheilt haben. Darüber
sprach man auch in Vorhelm. Auch Wulfbert aus Vorhelm
hatte davon gehört. Er hatte einen kranken Sohn namens
Amulger. Der Vater hatte die
Hoffnung, dass der inzwischen verstorbene Bischof
Liudger auch sein Kind heilen könnte und pilgerte
deshalb zum Grab des Heiligen im Kloster Werden bei
Essen. Das Kind wurde geheilt. Ein Mönch
des Klosters hat diese Begebenheit aufgeschrieben,
unmittelbar nach dem Jahr 864. Hier taucht zum ersten
Mal in der Geschichte der Name Vorhelm auf und zum
ersten Mal hören wir etwas über
gläubige Christen in Vorhelm. An der Kirche steht ein
Denkmal, das an Wulfbert erinnert.
Vorhelm
wird ein Kirchspiel
Vorhelm
war längst vor 1193 eine Pfarrgemeinde geworden, aber in
diesem Jahr wurde sie dem Archidiakonat St. Mauritz
unterstellt. Sie war dem heiligen Pankratius geweiht,
einem Patron, der bei den
Rittern und bei den Kreuzfahrern besonders beliebt war.
Dem Pfarrgebiet wurden die Bauerschaften Isendorf
(„Tönnishäuschen“), Eickel („Bahnhof“) und die
Dorfbauerschaft zugeordnet. Damit
wurde nicht nur die Pfarrgemeinde, sondern zugleich auch
das Dorf Vorhelm im rechtlichen Sinn errichtet. Die
Kirche wurde auf Grund und Boden des Hofes Borgmann
erbaut, der früher dem
Domkapitel gehörte. Deshalb ist anzunehmen, dass die
Kirche als Eigenkirche des Domkapitels gebaut wurde.
 Das einzige Foto von der "alten Kirche": Abbruch im März 1891 |
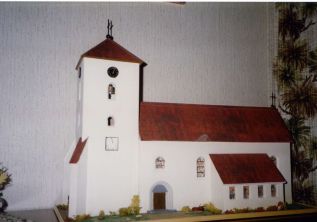 So könnte die "alte Kirche ausgesehen haben - Modell: Wolfgang Rüdiger |
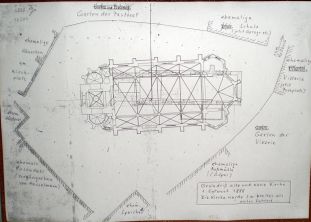 Grundriss von 1888 |
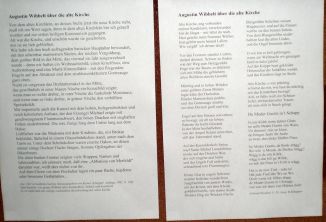 Wibbelt-Gedanken über die "alte Kirche" |
 So sahen die Vorgängerbauten unserer St. Pankratiuskirche aus (Alfons Oskamp hat diese Modelle gebaut) |
Die
alte Kirche
Sie
war eine romanische Kirche mit einer flachen Holzdecke,
daher schon vor dem Jahr 1150 erbaut. 1487 wurde durch
Witwe Nelle Torck eine Vikarie St. Anna mit einem Altar
gestiftet. In einer Rechnung
von 1521 ist davon die Rede, dass man die Kirche
eingeweiht habe. War sie entweiht worden? Es ist wohl
eher davon auszugehen, dass sie abgebrannt war, zumal um
1525 neue Glocken angeschafft
wurden. 1632, im Dreißig-jährigen Krieg, fiel sie
(wieder) einem Brand zum Opfer, wurde aber wieder
hergestellt und erst 1655 eingeweiht. Um die Kirche lag
der Friedhof. Am Turm war ein Gebeinhäuschen
angebaut. In der Kirche gab es im Chor Gräber für
Angehörige des Hauses Vorhelm und vor dem Chor Gräber
für die Geistlichen. Den Besitzern des Hauses Vorhelm
war das Patronatsrecht zugefallen.
Sie setzten in Abstimmung mit dem Pastor die Provisoren
ein. Sämtliche Kirchensitze waren „vermietet“. Jede
Familie hatte ihre festen Plätze.
Die
neue Kirche
Die
alte Kirche war nicht nur baufällig, sondern vor allem
zu klein geworden. 1891 wurde sie abgerissen. Es gab im
Pfarrgarten eine Notkirche, bis die neue am 25.10.1893
eingeweiht werden konnte.
Sie war gut doppelt so breit und knapp doppelt so lang
wie ihre Vorgängerin. Der Turm ragt mit 60 Metern hoch
hinaus. Der Spitzname „Klein Köln“ kam auf. Architekt
war zunächst Diözesanbaumeister
Hilger Hertel senior, nach dessen Tod sein gleichnamiger
Sohn.
 1951 (?): Messe in der Kirche mit Pastor Anton Janning und Vikar Heinrich Ahland auf der Kanzel |
 Blick zum Altar - 1994 |
Renovierungen
Eine
größere Renovierung geschah in den Jahren 1964-70
entsprechend den Vorstellungen des Konzils. Hochaltar,
Chorgestühl, Hochkanzel, Seitenaltäre und Kommunionbank
wichen einem neuen Altar
und einem neuen Ambo. Die Sakristei wurde vergrößert und
unterkellert.
1991-93
wurden Dach und Mauerwerk saniert und der Innenraum neu
gestrichen. Das Tabernakel wurde in eine Sandsteinstele
gefasst, die kleinen offenen Beichtstühle zu
Beichtzimmern umgebaut.
 Tabernakelwand 1992 |
 Tabernakelwand ab 20017 |
Der
Chorraum
Links
und rechts vom Tabernakel finden sich an den
Schrägwänden zwei Steinreliefs aus dem alten Hochaltar.
Das eine zeigt, wie Melchisedech Brot und Wein
darbringt, das andere, wie Abraham
seinen Sohn Isaak opfern will (ein Opfer, das Gott nie
will). Sie galten als Sinnbilder für das Messopfer.
Ebenfalls
aus dem alten Hochaltar stammen zwei größere Holzreliefs
an den Seitenwänden, welche die Taufe sowie die
Kommunion des hl. Pankratius darstellen. Jeweils links
und rechts daneben
finden sich kleinere Holzreliefs aus der alten
Hochkanzel. Sie stellen dar: Die Bergpredigt, die
Seepredigt, die Kindersegnung und die Tempelreini-gung.
Über
dem Tabernakel hing der Corpus des Gekreuzigten. Er
stammte als Dauerleihgabe aus einer Kreuzigungsgruppe
beim Hof Schulze Middig, deren Nebenfiguren Maria und
Johannes gestohlen
wurden. Das Tabernakel selbst stammt wieder aus dem
ehemaligen Hochaltar.
Oben an den Seitenwänden sieht man links die hl. Ida von
Herzfeld, was ursprünglich Hirschfeld bedeutet. Daher
der Hirsch an ihrer Seite. Gegenüber findet sich die hl.
Anna mit ihrer Tochter Maria.
Weihnachtsfenster |
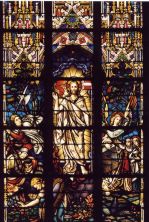 Osterfenster |
 Pfingstfenster |
 Die Heiligen (von links): Elisabeth, Michael, Cäcilia |
 Martyrium des hl. Pankratius |
 Die Heiligen (von links): Antonius, Anna und Liudger |
Die
Chorfenster
Sie
zeigen uns in den oberen Bildern von links nach rechts
die „Werke Gottes“: Die Menschwerdung, die Auferstehung
und die Geistsendung, entsprechend den kirchlichen
Hauptfesten Weihnachten,
Ostern und Pfingsten.
Darunter
sind sieben Heilige dargestellt. Sie stehen für das, was
Menschen mit den Gaben Gottes erreichen können: Es sind,
wieder von links nach rechts: Die
hl. Elisabeth von Thüringen mit den Rosen.
Sie steht für die christliche Nächstenliebe.
Der
hl. Erzengel Michael mit dem Schild und dem Schwert. Er
tritt mit seinem Fuß auf den Kopf des Teufels. Auf
seinem Schild liest man „Quis ut Deus?“. Es ist die
lateinische Übersetzung des
Namens Michael. Er bedeutet: „Wer ist wie Gott?“ Michael
steht für die Ehre Gottes und für den Kampf gegen das
Böse.
Die
hl. Märtyrerin Cäcilia ist die Patronin der
Kirchenchöre. Darum hat sie eine Orgel in der Hand. Sie
steht für das Lob, die Bitten oder die Klagen, die
Menschen betend oder singend vor Gott bringen.
Im
Mittelfenster ist das Martyrium des hl. Kirchenpatrons
Pankratius dargestellt. Links thront der römische
Kaiser, der den Tod des jugendlichen Christen befiehlt,
weil er sich weigert, den Kaiser anzubeten.
Im Hintergrund holt der Henker mit dem Schwert aus. Im
Vordergrund betet kniend Pankratius. Von rechts oben
reicht ein Engel dem Märtyrer Krone und Palme als
Siegeszeichen.
Im
rechten Fenster zunächst Antonius von Padua. Er wurde
von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis fast in die
Gegenwart in Tönnishäuschen sehr verehrt. Tönnishäuschen
war zeitweise ein richtiger
Wallfahrtsort, obwohl der eigentliche Patron der Kapelle
dort der Einsiedler Antonius ist. Antonius trägt das
Jesuskind und die Lilie.
Das
nächste Bild zeigt Mutter Anna mit ihrer Tochter Maria.
Auf einem Spruchband ist Jesaja 11,1 zitiert. Seit 1487
gab es in der Vorhelmer Kirche eine Vikarie und einen
Altar zur hl. Mutter Anna.
Schließlich
folgt ganz rechts der hl. Liudger, der erste Bischof von
Münster. Er trägt in seiner Hand die Abteikirche von
Essen-Werden, wo er begraben ist.
Die
übrigen Kirchenfenster sind alle späteren Datums und
ohne bildliche Darstellungen.
 Seitenkapelle |
Die
Kapelle
In der
Seitenkapelle (rechts) befindet sich an der Stirnwand eine
Holzstatue, die Maria mit dem Jesuskind darstellt. Maria
sitzt, und Jesus steht auf ihrem Schoß, dem Betrachter mit
segnender Hand zugewandt.
An
der Fensterwand hängt vorn eine Statue des hl.
Herman-Josef mit einem Apfel in der Hand, dann ein Foto
von der seligen Maria Gräfin Droste zu Vischering und
schließlich die hl. Agnes mit dem Lamm.
An der Wand gegenüber hängt ein Gemälde von der Aufnahme
Marias in den Himmel.
Das Kirchenschiff
Vor der
Kapellentür steht der Taufstein und in dessen Nähe eine
Holzstatue des hl. Pankratius, an dessen Grab in Rom die
Getauften ihr Taufversprechen erneuerten.
Eine
Marienstatue mit dem Jesuskind findet sich links vorne
in der Kirche.
Die
Kreuzwegbilder wurden nach längerer Auslagerung 1980
renoviert und wieder aufgehängt.
Die
ehemaligen Beichtstühle wurden in die neugeschaffenen
Beichtzimmer einbezogen.
An
der Rückwand des Mittelschiffes befinden sich zwei
Holzstatuen: Der hl. Antonius von Padua mit dem
Jesuskind und eine neue Statue der hl. Elisabeth mit den
Rosen. Die Statue des hl. Judas Thaddäus,
die vorher an dieser Stelle war, wurde in die
Turmkapelle gebracht.
Unter dem Turm
Hier
befinden sich zwei Kapellen: An der Südseite ist ein Bild
der Immerwährenden Hilfe und in der Nähe eine Vitrine mit
einer „Bückerbibel“.
Die
Kapelle an der Nordseite ist den Verstorbenen gewidmet.
Hier sind Gedenktafeln für die Gefallenen der Kriege
1815, 1864, 1870-71, 1914-18 und 1939-45, ferner eine
Holzstatue des hl. Josef mit
dem Jesuskind sowie ein Holzrelief der Kreuzigung,
darunter eine Vitrine mit dem Gedenkbuch der
Verstorbenen seit 1945.

Orgelbühne
Turmuhr
Turmkreuz 
Glocke
Orgel,
Uhr, Glocken und Kreuz
Die
ehemalige Orgel auf der Empore stand seitlich an den
Wänden in einer akustisch ungünstigen Position, um nicht
das große Westfenster zu verstellen. Sie war so schadhaft
geworden, dass sich eine
Reparatur nicht mehr lohnte. Zunächst diente eine kleine
elektronische Orgel vor der Sakristeitür als Ersatz. 1981
wurde eine größere elektronische Orgel auf der Empore
installiert, die inzwischen von
einer Computerorgel abgelöst ist.
Die
Kirchenuhr ist eine mechanische mit elektrischem Aufzug
und zwei Schlagglocken an der Stirnseite des Turmes für
Stunden- und Viertelstundenschläge.
Die
ehemaligen Kirchenglocken wurden im Krieg von den Nazis
beschlagnahmt. Die jetzigen Glocken wurden 1949 in
Gescher gegossen.
Das
alte Turmkreuz, das noch auf dem Kirchplatz zu sehen
ist, musste 1980 durch ein neues ersetzt werden.
Am 12.3.1986 wurde die Kirche unter Denkmalschutz
gestellt.
Literatur
über Vorhelm
Augustin
Wibbelt: Der versunkene Garten, 322 S., 1991, 6. Aufl.,
Hrsg. Rainer Schepper.
Theodor
Höwener: Aus der Pfarrchronik
von Vorhelm, 232 S., 1937 (im Pfarrarchiv).
Theodor
Höwener: Katholische Pfarrbücherei Vorhelm. (mit erstem
Teil der o.g. Chronik
und dem Büchereiverzeichnis), 107 S., 1937.
Pfarrchronik
1924-60, handgeschrieben (im Pfarrarchiv).
Heimatverein:
Vorhelm. Ein Heimatbuch, 160 S., 1954.
Heimatverein:
Vorhelm. Bildstöcke am Weg, 80 S., 1973.
Heimatverein:
Vorhelm in Bild und Wort, 100 S., 1975.
Heimatverein:
Uese Dichter Augustin Wibbelt, 57 S., 1978.
Johannes
Schulze Everding: Belauschte Natur. Tiergestalten in
Hecken und Bäumen (überwiegend Zeichnungen), 56 S.,
1977.
Johannes
Schulze Everding: Mit Augustin Wibbelt auf heimatlichen
Spuren, 90 S., 1984.
Anne
Schmitz: Das niedere Schulwesen im Kirchspiel Vorhelm in
den Jahren 1809 bis 1896, 170 S., Manuskript, 1983.
Pfarrgemeinderat:
Vorhelmer Kurzgeschichten, 56 S., 1990
Hermann
Honermann: Die St. Pankratiuskirche zu Vorhelm, 200 S.,
1993.
Hermann
Honermann/Christian Wolff: Tönnishäuschen. Kapelle und
Bauerschaft in Vorhelm. 282 S., 1999. Dazu Ergänzung:
Hermann
Honermann: 250 Jahre Kapelle Tönnishäuschen, 16 S., 2002
Adam
Georg Graf Schall: „In den Jahren des Kampfes um die
christliche Weltanschauung.“ Die katholische
Pfarrgemeinde St. Pankratius zu
Vorhelm in der Zeit der nationalsozialistischen
Herrschaftsetablierung. 2004. Manuskript.
Adam
Georg Graf Schall: „Mit wahrer Demuth und kindlichem
Zutrauen“. Caspar Maximilian Reichsfreiherr Droste zu
Vischering. Diplomarbeit, 91 S.
Hildegard
Latzel/Ursula Kiowsky: Dem de Holsken päß, de treckt en
sick an. Döhnkes und Anekdoten der Vorhelmer
Dorfgeschichte, 136 S., 2004.
Hans
Strack: Mosaik der Erinnerungen. Meine Zeit im
westfälischen Vorhelm. 2009. Hrsg. Heimatverein Vorhelm.
Hermann
Honermann: Häuser- und Personenlisten des Kirchspiels
Vorhelm 1498-1832, 157 S, 2010.
Hermann
Honermann: Das Dorf vor der Helle. Aus Vorhelms ältester
Geschichte. Bielefeld 2021
Artikel in anderen
Büchern und Schriften
A.
Ludorff: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Beckum,
1897, S. 83-87
Anton
Schulte: Zur älteren Geschichte von Vorhelm, in: Quellen
und Forschungen zur Geschichte des Kreises Beckum, Bd 5,
S. 248-266 (1953/54)
Kunst
im Kreis Warendorf, S. 44-56: Ludger Schulte:
Ahlen-Vorhelm 1991.
Michael
Rüther: Altes Siedlungsgelände in Vorhelm In: Heinrich
Kemper: Spuren der Vergangenheit. Archäologie in Ahlen,
S. 59-60.
Hermann
Honermann: Gaststätten in Vorhelm, in „Münsterland.
Jahr-buch des Kreises Warendorf“ 2013, S. 65-69, 2014,
S. 198-207, 2015, S. 220-221
Hermann
Honermann: Johannes Schulze Everding. Leben, Werk und
Würdigung eines namhaften Vorhelmers, in „Münsterland.
Jahrbuch des Kreises Warendorf“ 2014, S.363-369.
Hermann
Honermann: Vom Schwerbrocker Leichweg zur Dorffelder
Straße. Alte Wege und Bauerschaften in Vorhelm, in
„Münsterland. Jahrbuch des Kreises Warendorf“ 2018, S.
70-75
Paul
Eckholt: Eisernes Brevier. Erzählungen, Gedichte. Darin
S. 126-149: Vorhelmer Tage.
Heinz-Jörg
Eckhold:
Die Rundholz. Deutsche Familiensaga... S. 111-129 Ferien
in Vorhelm, auch an anderen Stellen. (Pfarrbücherei)
Ferner:
Etliche
Jubiläumsschriften der Vereine., Artikel im „Beflügelten
Aal“, Kopien und Notizen aus verschiedenen Archiven,
besonders aus dem Archiv des Hauses Vorhelm.
Hier geht es zu den Fotos vom
Altarraum,
Innenraum,
Figuren,
Kreuzweg,
Krippen
und
Kirche von außen.
Hier geht es...
- zu den aktuellen Pfarrnachrichten
- zu interessanten Terminen
- zu Fotos aus der Vergangenheit
- zu Presse-Artikeln aus früheren Zeitungen
- zu interessanten Beiträgen aus früheren Pfarrbriefen "KONTAKTE"
häuschen
Startseite


